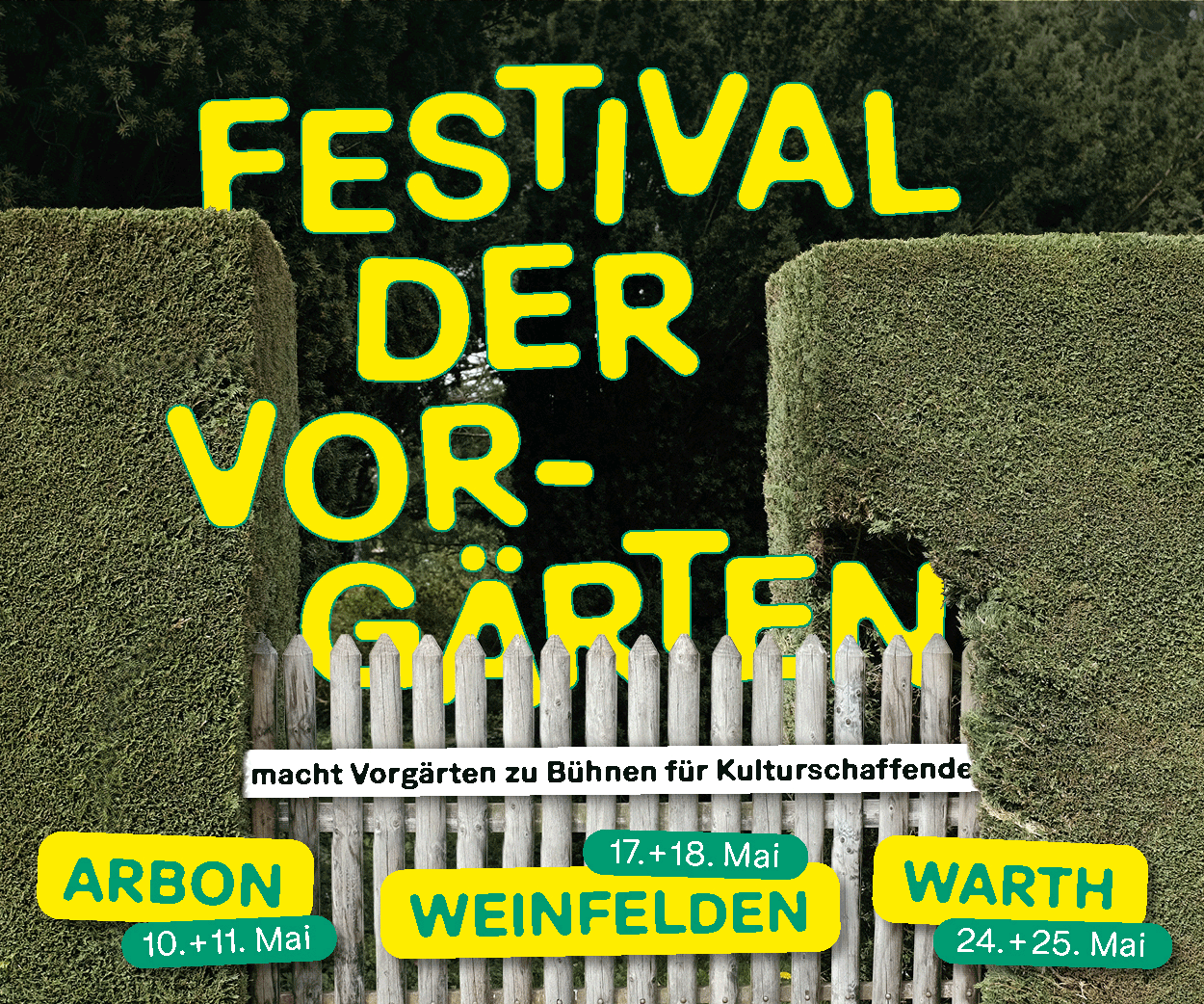von René Munz, 15.06.2009
Wie kommt die Kultur zu ihrer Lobby?

Ist der Kulturfahrplan des Think Tank Thurgau gescheitert? Projektleiter Alex Bänninger ist enttäuscht, dass in den vergangenen 5 Jahren von den 22 Postulaten nur ein paar wenige umgesetzt oder halbwegs realisiert worden sind. Ich sehe darin kein grosses Unglück für die Kulturszene des Kantons Thurgau. Am allermeisten zu bedauern ist aber, dass es nicht gelungen ist, eine spürbare Kulturlobby zu bilden.
René Munz
Immerhin wurden wesentlich mehr Postulate umgesetzt, als Alex Bänninger es wahrhaben will. Die Punkte 1 - 6 etwa (mit Stolz vorhandenes Potential ausschöpfen, Kultur als Wirtschaftsfaktor ernst nehmen, unternehmerisch investieren, den Thurgau als europäische Region profilieren, die Breitenförderung um Spitzenförderung ergänzen und Probleme entschlossen an der Wurzel packen) werden sinngemäss im Kulturkonzept des Kantons Thurgau berücksichtigt und Schritt für Schritt umgesetzt. So war gerade anlässlich der öffentlichen Übergabe der Förderbeiträge des Kantons Thurgau an Kulturschaffende eindrücklich festzustellen, dass zum Beispiel die persönliche Förderung in vielen Fällen (wenn auch erwartungsgemäss nicht in allen) dazu beiträgt, dass sich Kunstschaffende national oder gar international vernetzen und etablieren können.
Das auch im Kulturfahrplan postulierte Internet-Kulturportal ist umgesetzt (Punkt 08), eine gewisse Professionalisierung wird „beherzt unterstützt", sofern die Professionalisierung auf entsprechender Kompetenz beruht (Punkt 10), die Gemeinden werden bewusst stärker in die Kulturfinanzierung eingebunden (Punkt 11), private Kulturförderer können steuerlich entlastet werden, sofern sich die entsprechenden Kulturinstitutionen als gemeinnützig registrieren lassen (Punkt 12). Die privilegierte Spitzenförderung wird Schritt für Schritt vorangetrieben (Punkt 14), für die Schaffung eines kulturellen Erlebnisraums Untersee wäre ein Projektkredit zur Verfügung gestanden, der von Projektleiter Alex Bänninger aber nicht in Anspruch genommen wurde.
Natürlich kann man der Meinung sein, dass diese Postulate viel zu zurückhaltend und zu wenig beherzt umgesetzt werden und dass sich in der politischen Haltung im Kanton noch zu wenig geändert habe. Das hätte dann mit dem für mich wichtigsten Kulturfahrplan-Postulat Nr 22 zu tun: der Bildung einer Lobby für die Kultur. Dass dieser Punkt nicht umgesetzt wurde, bedaure auch ich ausserordentlich. Eine Frage blieb aber schon bei der Publikation des Kulturfahrplans unbeantwortet: Wie kann man eine solche Lobby aufbauen und etablieren? Wer kann das? - Dazu gibt der Kulturfahrplan keine Auskunft.
Es wurden in den vergangenen Jahren ein paar kulturelle Projekte verwirklicht, die nicht im Kulturfahrplan aufgeführt sind, die für die Thurgauer Kulturszene dennoch eine nachhaltige Verbesserung und einen positiven Einfluss haben (regionale Kulturpools im Hinterthurgau und im Bezirk Diessenhofen - weitere folgen; das Theaterhaus als Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Schultheater in Weinfelden; die kantonsübergreifende Tanzförderung „Tanzplan Ost" usw.). Nicht nur die Ideen im Kulturfahrplan sind wichtig, es können auch andere Ideen sein.
Einige der Postulate im Kulturfahrplan waren zum Vornherein zum Scheitern verurteilt, weil entweder ein echtes Bedürfnis fehlt, weil eine Idee zu wenig durchdacht in den Raum gestellt wurde oder weil es niemanden gibt oder gab, der selber von einem solchen Projekt überzeugt ist und es auch schafft, viele andere dafür zu motivieren und mitzureissen. Ein paar Fragen zu einzelnen Vorschlägen seien erlaubt:
Brauchen wir wirklich ein Ostschweizer Kunsthaus als Konkurrenz zu Bregenz, St. Gallen, Vaduz, Winterthur, Schaffhausen, Zürich (Postulat 17)? Wäre es nicht dringlicher und ergiebiger, das bestehende Kunstmuseum Thurgau - das nicht nur auf den Kulturtourismus, sondern auch auf die Kunstförderung und die Kunstvermittlung in der Region ausgerichtet ist - zu stärken mit besseren finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen, damit es wieder vernehmlicher auf nationaler und auf internationaler Ebene mitspielen kann? Das Kunstmuseum ist ein nationaler Player, muss sich aber mit Mitteln eines regionalen Museums begnügen. Ich glaube nicht, dass ein neues Kunsthaus plötzlich mit ganz andern Mitteln finanziert würde. Und ich glaube auch nicht, dass nach einer Privatisierung plötzlich mehr private Gelder vorhanden wären.
Wäre zum Beispiel die Einrichtung eines multifunktionalen Kulturzentrums, das Kunstschaffenden verschiedenster Sparten zur Verfügung stünde, wo Projekte nicht nur gezeigt, sondern auf nationalem Niveau erarbeitet, produziert werden könnten, nicht wünschbarer für unseren Kanton als ein weiterer, unterdotierter Kunstraum?
Oder nehmen wir den Vorschlag „Kulturhauptstadt": Wäre es wirklich sinnvoll, einer Gemeinde einen hohen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen und abzuwarten, was damit gemacht wird - egal ob jemand dann gerade eine gute Idee hat oder ob halt nur ein Bierfest mit Darbietungen realisiert wird?
Ich halte die Idee für eine nicht durchdachte Fehlkonstruktion und meine, es wäre der geschicktere (und auch übliche) Ansatz, wenn jemand zuerst eine Idee, ein Konzept und einen Umsetzungsplan vorlegt, um in den Genuss eines besonderen Beitrags zu kommen. Ein solches Vorgehen steht aber auch ohne Stempel „Kulturhauptstadt" jeder Gemeinde jederzeit frei. Es gäbe allen Grund für die Gemeinden, in einen Wettbewerb zu treten um die Gunst des Publikums, der Medien und der Kulturschaffenden. Gute Ideen sind immer gefragt, Mittelmässiges haben wir aber mehr als genug.
Oder der Vorschlag „Stiftung Thurgauischer Kulturbesitz": Ich sehe noch immer nicht ein, welche wesentlichen Verbesserungen eine Privatisierung den Museen bringen würde, solange diese in hohem Grad von öffentlichen Mitteln abhängig sind (und das werden sie weiterhin sein, denn es gibt auch in unserem Kanton schlicht und einfach zu wenig private Kulturfinanzierer). Das hochgelobte Dogma „privat ist gut, Staat ist schlecht", dürfte wohl spätestens nach dem Versagen der Finanz- und Spekulationswirtschaft an Überzeugungskraft eingebüsst haben.
Ausserordentlich zu bedauern ist, dass folgende Postulate (noch?) nicht umgesetzt werden konnten:
Nr. 19: Integration von Kultur, Schule und Wirtschaft. Da fehlt nach wie vor zumindest eine fachkompetente Vermittlungsstelle zwischen Schule und professioneller Kultur.
Nr. 21: Erweiterung der finanziellen Spielräume. Das ist eine rein politische Frage, verbunden mit der Frage, wie hoch die Kultur gewichtet wird - auch wenn es um Steuersenkungen geht. Das Bewusstsein dafür entwickelt sich wohl nicht ohne Umsetzung des letzten Postulates:
Nr. 22: Bildung einer Kulturlobby. Auf politischer Ebene - in den Gemeinden und im Kanton - müsste die Einsicht weiter wachsen, dass Kultur ein wichtiger Standortfaktor ist und gesellschaftliche Relevanz hat. Dass Kultur auf staatspolitischer Ebene nicht primär Hobby, Verein und Freizeit bedeutet, sondern Professionalität und dass es eine entsprechende Infrastruktur braucht.
Im Gegensatz zum Sport fehlen der Kultur entsprechende Strukturen oder Foren, um sich besser zu organisieren. Oft fehlt auch der Wille, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Es gäbe da nach wie vor ein grosses Potenzial, das nicht im Alleingang, sondern nur gemeinsam, kooperativ erschlossen werden könnte.
Es ist Alex Bänninger hoch anzurechnen, dass er sich mit seinen Vorschlägen zur Stärkung des kulturellen Lebens im Thurgau exponiert und leidenschaftlich Stellung nimmt. Ich wünsche mir, dass die Diskussion über die Thurgauer Kulturförderung und über die Qualität der Thurgauer Kulturszene auch unabhängig vom Kulturfahrplan weiter geführt wird.
***
Kommt vor in diesen Ressorts
- Kulturpolitik