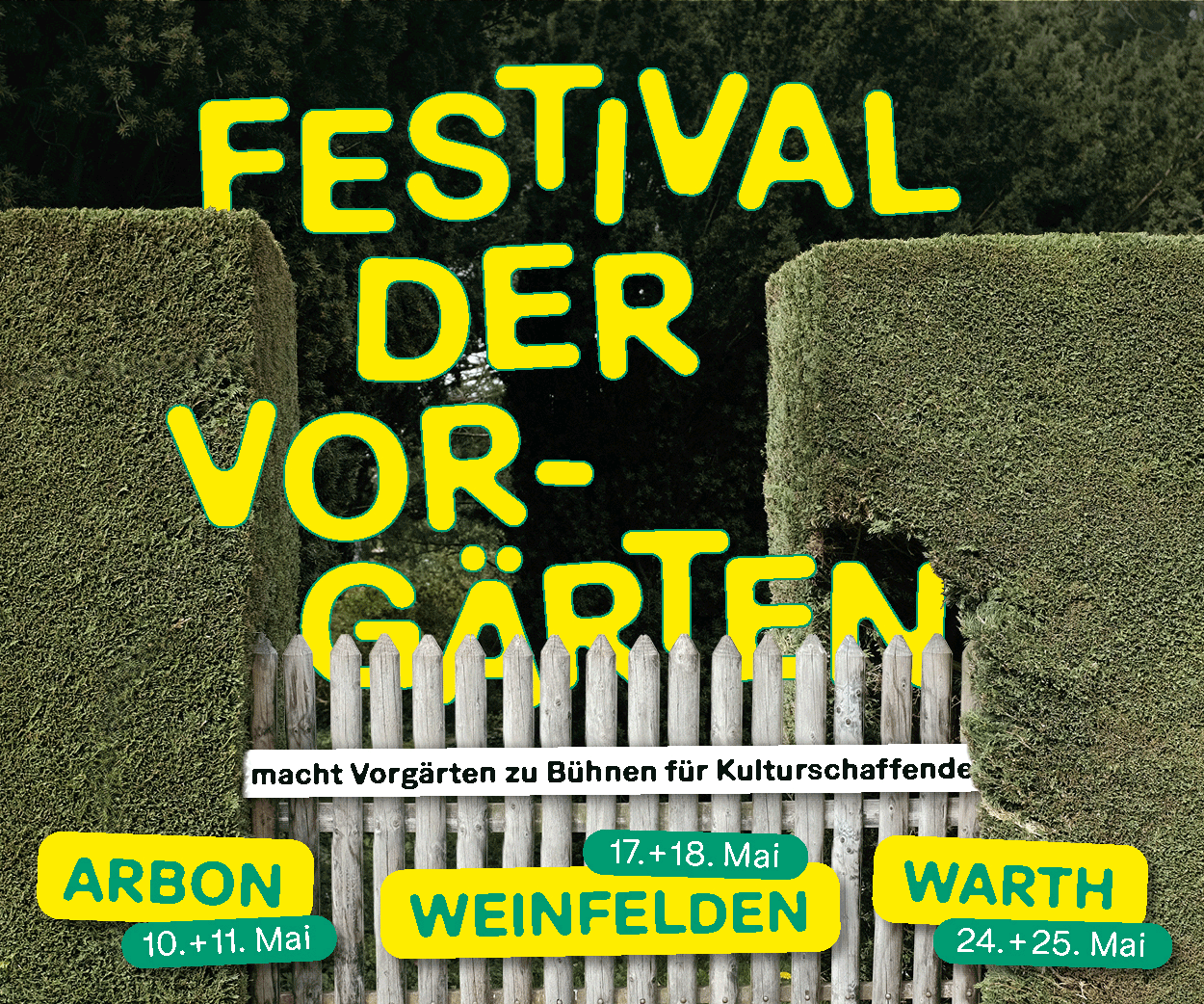von Bettina Schnerr, 27.02.2022
Die schwierige Kunst des Brückenbaus

Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Und kann die Kultur dabei helfen, entstandene Gräben zu überwinden? Der Themenabend «Bridges over troubled bubbles» von Kulturstiftung und thurgaukultur.ch im Kreuzlinger Kult-X suchte nach Antworten. (Lesedauer: ca. 6 Minuten)
Zumindest das Gröbste der Corona-Krise scheinen wir hinter uns zu haben, doch die Aufräumarbeiten kommen erst noch. Verschiedene Meinungen gab es schon immer, doch so verhärtete Fronten in gehäufter Form erlebten wir schon lange nicht mehr.
Wie sich Wege aus dem gesellschaftlichen Stillstand finden lassen, darüber sprach Moderator Stephan Militz vom Kult-X in der Talkrunde „Bridges over troubled water“, Teil der Veranstaltungsserie zum 30-Jahre-Jubliäum der Kulturstiftung des Kantons Thurgau.
Seine Gäste waren Filmemacherin, Künstlerin und Journalistin Samantha Zaugg, Schauspieler und Regisseur Simon Engeli, Kulturvermittlerin Christine Müller Stalder, Alex Meszmer, Geschäftsführer von Suisseculture, Musiker David Nägeli sowie Monika Knill, Regierungsrätin für Erziehung und Kultur im Kanton Thurgau.

Ein Selbstversuch: Reden mit den anderen Bubbles
Eine erste Einordnung nimmt zunächst Samantha Zaugg vor. In ihrer Performance zeigt sie pointiert auf jene Faktoren, die mindestens als Brandbeschleuniger gelten dürfen, nämlich die Tech-Giganten aus den USA und ihre Angebote. Sowohl die Suchmaschinen als auch die Sozialen Medien basieren auf Algorithmen, die darüber entscheiden, welche Informationen wir angezeigt bekommen.
Deren Programmierung ist unklar; sicher ist allerdings, dass fundierter, wenig geklickter Inhalt kontroversen Angeboten oder peppigen Filmen unterliegt und die Algorithmen auf diese Weise Inhalten mit Spaltpotenzial die Verbreitung erleichtern.
Video: Jetzt die gesamte Debatte anschauen
Was ist dran an gängigen Verschwörungserzählungen?
In fiktiven Publikumsgesprächen nimmt Zaugg Kontakt zu Menschen ausserhalb ihrer Bubble auf. Was mit dem Thurgauer Maler Adolf Dietrich ganz humorig anfängt („er hat nicht besonders gut gemalt, aber dafür sehr viel“), greift schnell die kruden Verschwörungserzählungen auf, die inzwischen vermehrt kursieren.
Sie setzt sich unter anderem mit der Legende auseinander, die Schweiz stünde kurz vor einem Bürgerkrieg und spricht über Vergleiche zum Holocaust, die so unpassend wie hartnäckig sind.
Rückblick auf die Kultursparflamme
In der nachfolgenden Runde blickt Stephan Militz zunächst auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Soll die Kultur als gesellschaftlicher Kitt funktionieren können, so war ihr diese Aufgabe da nicht in vollem Umfang möglich. Doch das, was möglich war, fiel positiv auf, wie ein Beispiel von Simon Engeli zeigt.
Mit der Theaterwerkstatt Frauenfeld konnte er 2020 eine kleine Tournee auf die Beine stellen und erlebte ein besonders wohlwollendes Publikum: „Die Leute kamen auch unter erschwerten Bedingungen, weil sie das Theater erleben wollten.“

Manches funktionierte gut, anderes weniger
Die Umstellung auf digitale Angebote allerdings glich einem Wellenritt mit unterschiedlich gutem Ausgang. Während die Kulturvermittlerin Müller Stadler mit Zoom-Führungen sehr gute Erfahrungen machen konnte, funktionierten andere Angebote wenig zufriedenstellend.
„Konzerte habe ich wegen der Soundqualität schnell aufgegeben,“ erinnert sich Zaugg. „Lesungen in kleinen Gruppen hingegen habe ich sehr positiv erlebt.“
Für Alex Meszmer wiederum boten die digitalen Kanäle überhaupt erst die Möglichkeit, seine Arbeit für Suisseculture und die Taskforce Culture zu realisieren. „Ab März 2020 habe ich praktisch in Zoom gelebt, oft mit langen Abenden,“ erzählt er. „Nicht selten bis nachts um zehn.“
Brücken schlagen am Lagerfeuer
Ein übergreifendes Bild von Simon Engeli prägt den Abend: Das „Geschichten austauschen am Lagerfeuer“ sei das Urbedürfnis des Menschen, das die Gesellschaft zusammen halte. Umso mehr, wenn man es nicht ohne Weiteres erleben könne.
Beim Zuhören am Abend fällt auf: Begegnet man sich über lange Zeit nicht, verlernt man den essentiellen Austausch. Möglicherweise liegt hier ein wesentlicher Grund, der die wahrgenommene Spaltung hervorruft.
Dafür spricht die Beobachtung von Monika Knill: „Es ist spürbar schwieriger geworden, verschiedenen Meinungen zu akzeptieren,“ stellt sie fest. Doch der Begriff Spaltung ist ihr zu gross gegriffen. „Ich spreche lieber von Zersplitterung,“

„Es ist spürbar schwieriger geworden, verschiedenen Meinungen zu akzeptieren.“
Monika Knill, Regierungsrätin für Erziehung und Kultur im Kanton Thurgau (Bild: Bettina Schnerr)
Eine, die eigentlich nicht neu sei: „Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft schon immer unterschiedliche Meinungen kultiviert hat,“ schliesst Müller Stalder an. „Gewisse Gräben wie Klassismus oder Stadt-Land-Kontroversen gab es schon zuvor.“
Gehe es darum, Gräben zu überwinden, brauche es Inhalte und Rituale gleichermassen: „Sich passend anziehen, aus dem Haus gehen, Billets kaufen ... eine verfeinerte Form vom Lagerfeuer. Das ist ein massgeblicher Teil des Austauschs im öffentlichen Raum,“ findet Simon Engeli.
Soziale Medien als Problem oder Lösung?
Schaut man sich nicht nur Engelis Analyse an, fällt die Antwort „Lösung“ an diesem Abend aus. Unzählige Kunstschaffende haben beispielsweise Streams ausprobiert. „Doch wenn ein kleines Theater streamt, ist dein Konkurrent im Zuschauerverhalten nicht ein anderes Theaterhaus im Thurgau, sondern Netflix,“ bilanziert der Regisseur. „Vom Sofa aus trifft man andere Entscheidungen.“
Der Musiker David Nägeli erklärte weitere Probleme: „Einerseits müssen die Kanäle bespielt werden, um sichtbar zu bleiben. Andererseits erschweren intransparente Algorithmen die Beurteilung dessen, was gerade zählt.“ Keine stabile Arbeitsgrundlage: Die sozialen Medien zeigten sich ihm zwar lange als Hauptkontakt zur Welt, aber eben auch als schwer durchdringliches Labyrinth.
Gleichzeitig ist das Ausmass an digitalem Umgang auf eine ganz andere Art zehrend als herkömmliche Arbeit. Nägeli und Zaugg hatten beispielsweise Seiten- und Zeitsperren als Selbstschutz eingerichtet. Für eine reine Digital-Strategie in der Kultur spricht das eher nicht.
Die Kultur braucht hybride Angebote
Die künftige Kulturarbeit kann sich die Runde nur in Mischformen vorstellen. „Für mich ist virtueller Brückenbau nicht nachhaltig. Ein Klick und alles ist wieder weg,“ ist Monika Knills Eindruck. „Wenn es um Emotionen geht, und davon lebt die Kultur massgeblich, geht das nur analog.“
Digitale Angebote verstehe sie eher als Begleitung. „Ich weiss nicht einmal, mit wem ich interagiere in einem Netz, wo man sich fast anonym bewegen kann.“
Am besten funktioniere Kultur wohl, wenn dafür verschiedene Werkzeuge zusammen spielen könnten, ist Meszmers Erfahrung. Aus der Arbeit mit seinem digitalen Museum in Pfyn weiss er, dass sein sehr heterogenes Publikum über jeweils andere Mechanismen angesprochen wird: „Physisch vor Ort sind nicht die Leute, die es digital gesehen haben.“

„Wer lieber auf Kontroverse setzt statt Inhalte in den Vordergrund rückt, kann Kunst nicht sinnvoll repräsentieren.“
David Nägeli, Musiker & Künstler (Bild: Bettina Schnerr)
Nägeli sieht die Fokussierung auf Soziale Medien als ungeeignet: „Wer lieber auf Kontroverse setzt statt Inhalte in den Vordergrund rückt, kann Kunst nicht sinnvoll repräsentieren.“ Insofern haben die letzten zwei Jahre zumindest etwas Gutes, nämlich ausreichend Erfahrungen für eine selektive, formatgerechte Auswahl.
Es gebe grossartige digitale Angebote, aber das Zusammenbringen ist für das Überbrücken an sich das Entscheidende, sagt er: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich auch bei kontroversen Themen gemeinsame Momente finden liessen. Konsens haben wir nicht gefunden, sind aber im Dialog geblieben.“
Nichts ist so beständig wie der Wandel
Die kommende Aufgabe fasst Christine Müller Stalder zusammen: „Es geht darum, die Leute wieder zu locken, dafür eine Sprache zu finden und das Erleben neu schaffen.“ Und das Rezept? „Die Angebote müssen stimmen,“ sagt Zaugg. „Theater versus Netflix ist der falsche Vergleich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.“
Und eine Stimme aus dem Publikum ist sich sicher, dass die Kultur vor allem den Sozialen Medien die Nase voraus habe: „Wenn digital die Inhalte völlig wurscht sind, kann Kultur genau damit dagegenhalten.“
Sicher hätten sich Seh- und Konsumgewohnheiten verändert. Doch das Publikum wieder zu erreichen und allenfalls neue Formen zu finden, sei nicht so schwierig: „Weil sich die Kulturschaffenden dauernd anpassen und verändern müssen,“ sagt Meszmer. „Das ist eine ihrer Grundfähigkeiten.“ Ergänzt durch eine passende Kulturvermittlung, denn Dockingstellen für das Publikum zu schaffen, sei ihre ureigene Aufgabe, ergänzte Müller Stalder.

Die wahren Herausforderungen liegen woanders
Gerade wenn man an Brückenbau denkt, liegt eine andere Stelle im Argen: „Wie erreicht man Menschen, die sich erkennbar nicht mehr als Teil der Gesellschaft verstehen?“ fragte Engeli. Die Skepsis dem Staat gegenüber habe sich nicht erst mit der Pandemie entwickelt und „diese Leute kommen nicht ins Theater“.
Eine Rolle könnte die öffentliche Aufmerksamkeit spielen. Sind die Scheinwerfer bald neu ausgerichtet, verschwänden die Bewegungen wieder in der Nische. Dann wären sie zumindest nicht mehr künstlich aufgebläht, aber natürlich nicht weg. Ob Kultur hier eine Chance bietet? Eine Frage, die an diesem Abend offen blieb.
„Kultur kann Mechanismen der Radikalisierungen nicht aufwiegen.“
Samantha Zaugg, Künstlerin & Journalistin
Zudem kann nicht jede Stellschraube von der Kultur bedient werden, wie Samantha Zaugg feststellt: „Kultur kann Mechanismen der Radikalisierungen nicht aufwiegen.“ Je nach Fall müssten politische Mittel her, wie sich am Beispiel der Sozialen Medien zeige. „Die stellen sich gerne hilflos dar,“ sagte sie.
Doch mit ihrer Argumentation, „man könne halt nichts machen“, blendeten sie gezielt einen entscheidenden Aspekt aus der öffentlichen Wahrnehmung aus: „Das sind hoch innovative Unternehmen, die ihre Tools sehr bewusst gestalten.“ Zusätzlich zu Überlegungen, wie sie zur Neugestaltung des Urheberrechts exisitierten, müssten weitere Verpflichtungen formuliert werden.
Die Verführung des Publikums
Von diesen zwei offenen Positionen abgesehen, ist das Fazit des Abends soweit klar: Der Stellenwert der Kultur und die Akzeptanz des Publikums sind ungebrochen. Die Vision einiger Philosophen, dass die Post-Pandemie-Welt eine ganz andere sein würde, sieht im Saal niemand.
Die Grundbedürfnisse des Menschen seien eben älter als nur zwei Jahre. Die Rückkehr allerdings braucht etwas Geduld. Alex Meszmer schätzt, dass es zwei bis drei Jahre brauche, um zur Situation vor der Pandemie aufschliessen zu können.
Das passende Schlusswort fand eine Stimme aus dem Publikum: Man erlebe sicher eine hohe Verführung, bequem einem Film zu folgen. „Aber das Bedürfnis nach Begegnung erfüllt das Internet nicht. Wenn den Menschen die Begegnung vor der Pandemie etwas gegeben hat, dass werden sie sie in den kommenden Angeboten auch wieder suchen.“
Weiterlesen: Auch das Ostschweizer Kulturmagazin Saiten hat über den Abend berichtet. Den Text findest du hier.
Mehr zu 30 Jahre Kulturstiftung
Kommende Termine der Veranstaltungsserie „30 Jahre Kulturstiftung des Kantons Thurgau“
Karriere? La danse n’existe pas – oder doch?
Die Tanzschaffenden Muhammed Kaltuk, Wittha Tonja und Mirjam Bührer zeigen ihre Kunst und diskutieren mit der Tanzförderin Anna Bürgi (Stadt Zürich) und der Tanzjournalistin Lilo Weber (u.a. NZZ) über Karrieren im zeitgenössischen Tanz.
Datum: 15.3.2022, 19:30 Uhr
Ort: Kulturzentrum Kult-X, Kreuzlingen

Weitere Beiträge von Bettina Schnerr
- Dreckiges Erbe (20.02.2023)
- Wie hart trifft die Energiekrise die Kulturbranche? (28.11.2022)
- Plötzlich Hauptfigur (14.11.2022)
- Hinter den Kulissen von Licht- und Farbenzauber (09.09.2022)
- Jägerin des verborgenen Schatzes (04.07.2022)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Bericht
- Digital
- Medien
Ähnliche Beiträge
Alte Frage gelöst, neues Rätsel gefunden
Einmal im Jahr ziehen die Archäologen des Kantons Bilanz und berichten der Öffentlichkeit, was sie in den vergangenen zwölf Monaten herausgefunden haben. mehr
Wissen macht glücklich
«Wie wir arbeiten» (2): Kaum jemand schreibt schon so lange für uns wie Inka Grabowsky. Für sie ist das Gefühl, wenn der Groschen fällt, unbezahlbar. mehr
Forschungspreis geht an Thurgauer Uni-Professor
Tobias Mettler wird mit dem Forschungspreis Walter Enggist 2024 ausgezeichnet. Der Thurgauer Wissenschaftler hat sich in seiner Arbeit mit der vernetzten Arbeitsplatzüberwachung beschäftigt. mehr